Kommunalpolitik geht jeden etwas an – eine Studentin aus Potsdam macht sich Gedanken
Autorin: Christiane Barna, Praktikantin in der SGK Brandenburg
Am 26. Mai 2019 finden in Brandenburg, zum zweiten Mal zeitgleich mit den Europawahlen, die Kommunalwahlen statt. In diesem „Superwahljahr“ wird im September außerdem ein neuer Landtag gewählt und die Vorbereitungen der Parteien auf die jeweiligen Wahlen sind bereits seit einiger Zeit angelaufen.
Obwohl nun also die Kommunalwahlen direkt vor der Tür stehen und die Kandidaten bis zum 21. März (12 Uhr!) feststehen müssen, haben noch nicht alle Parteien ihre Listen beschlossen und auch viele parteilose Kandidatinnen und Kandidaten sind noch nicht ganz entschlossen.
Besonders für die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen fällt es nicht immer ganz leicht, Bewerberinnen und Bewerber für die Ehrenämter zu finden.
Gewählt werden, neben den Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte, aber auch die Kreistage der 14 Landkreise und die Stadtverordnetenversammlungen der vier kreisfreien Städte, sowie die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher oder Ortsbeiräte.
Auf die Kandidatinnen und Kandidaten
kommt es an!
Der Wahlkampf auf kommunaler Ebene ist ein anderer als beispielsweise auf Landes- oder Bundesebene. Parteipolitische Interessen spielen hier oftmals eine untergeordnetere Rolle. Es kommt vor allem auf die Kandidierenden an. In der eigenen Gemeinde sind sie den meisten Einwohnern unter Umständen schon bekannt und so können sie gezielt auf die Wünsche, Interessen und Probleme ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger eingehen. Das macht Kommunalwahlen zu einer sehr viel persönlicheren Angelegenheit.
Die Bürgerinnen und Bürger haben aber gerade dadurch die Möglichkeit, aktiv mitzubestimmen, wer Ihre Interessen vertreten soll oder ob sie sogar selbst Vertreter sein wollen. Die Wählerinnen und Wähler legen ihr Vertrauen letztlich oftmals in die Hände derjenigen, mit denen sie sich am ehesten identifizieren können. Das müssen nicht immer Parteimitglieder sein.
Besonders in kleineren Gemeinden, in denen nur wenige Sitze errungen werden können, werden deshalb wohl oftmals vorrangig unabhängige Kandidateninnen und Kandidaten gewählt.
Noch Potenzial
Obwohl in einigen Gemeinden und
Gemeindeverbänden die Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen nun bereits seit
Ende letzten Jahres laufen, Kandidatenlisten aufgestellt und Wahlprogramme
verabschiedet werden, ist bei der Gewinnung potenzieller Kandidatinnen und
Kandidaten durchaus noch Luft nach oben, auch wenn sich viele engagierte „alte
Politikhasen“ erneut zur Wahl aufstellen.
Sicherlich beeinflusst auch das, was Parteien auf Bundes- und Landesebene tun oder lassen das Wahlverhalten. Dass viele Bürgerinnen und Bürger vor einer Kandidatur zurückschrecken, hat aber vermutlich noch andere Ursachen. Beispielsweise steht eine Gemeindevertreterin oder ein Gemeindevertreter in der Öffentlichkeit und muss sich für Wort und Tat manchmal sogar rechtfertigen. Das liegt nicht jedem.
Unsere moderne, sich ständig wandelnde
Gesellschaft und Arbeits- und Lebensverhältnisse, die zum Beispiel auch
tägliches Pendeln notwendig machen, sorgt manchmal auch dafür, dass es manchmal
an einer Identifikation mit dem Wohnort fehlt. Da auf kommunaler Ebene
getroffene Entscheidungen aber unser aller Alltag mitbestimmen, ist es umso
wichtiger, dass sich Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv beteiligen wollen,
für ihre Kommunen einsetzen. Sei es, indem man sich zur Wahl stellt oder indem
man wählen geht.
Sich neben Beruf und Familie noch ehrenamtlich für die Gemeinde zu engagieren, ist zweifellos zeitaufwändig. Es erfordert nicht nur Leidenschaft, sondern zudem eine Menge Geduld und Durchhaltevermögen, ist aber auch spannend und praxisnah. Als Gemeindevertreterin oder Gemeindevertreter hat man aber die Möglichkeit, mit Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und gemeinsam die lokale Politik zu planen und zu gestalten. Diese Chance sollten wir nutzen!
Die SPD, die bereits in einem Großteil der
Kreise Wahlprogramme und Kandidatenlisten beschlossen hat, versucht zu mehr
kommunalpolitischem Engagement anzuregen, insbesondere indem Neu-Mitglieder zur
Kandidatur ermutigt werden. In den Landkreisen Teltow-Fläming und Oberhavel hat
man sich bereits im Dezember auf die Kandidatenlisten für die jeweiligen
Kreistage geeinigt. Auch in den vielen Städten und Gemeinden wie beispielsweise
in Eberswalde, Panketal, Falkensee, Henningsdorf, Oranienburg und Teltow haben
sich bereits viele Politikbegeisterte zur Wahl aufstellen lassen. Die SPD
Potsdam hat als erste Partei in der Landeshauptstadt die Liste für die Wahl zur
Stadtverordnetenversammlung gefüllt. Mit jeweils drei weiblichen und drei
männlichen Spitzenkandidaten geht sie ins Rennen und will sich für mehr soziale
Gerechtigkeit einsetzen.
Die Linke, die ihre ersten Kandidaten und
Kandidatinnen bereits im November letzten Jahres nominiert hat, wird wieder mit
offenen Listen antreten und unterstützt insbesondere die Kandidatur weiblicher
Bewerberinnen.
Erst in vereinzelten Landkreisen haben die Grünen ihre Kandidatenlisten beschlossen. Der Landeschef der Grünen gibt sich allerdings zuversichtlich, die Kreistagslisten füllen zu können.
Verstärkt auf Parteilose setzt wohl die AfD, was vermutlich auch daran liegt, dass es ihnen an Kandidatinnen und Kandidaten in den eigenhen Reihen mangelt.
Wählen gehen!
Insgesamt fehlen in den Brandenburger Landkreisen und Gemeinden aber nicht nur Kandidateninnen und Kandidaten, sondern auch Wählerinnen und Wähler. Schon bei den letzten Kommunalwahlen 2014 war die Wahlbeteiligung besorgniserregend niedrig. Nicht einmal die Hälfte aller Wahlberechtigten hatte einen Stimmzettel ausgefüllt.
Damit hatte die Wahlbeteiligung in Brandenburg einen noch nie da gewesenen Tiefstand erreicht. Und das, obwohl Brandenburg zu den Ländern gehört, die durch die Ausdehnung des Wahlrechts mit der Wahlberechtigung ab 16 Jahren versuchen, die Partizipation und das Interesse zu fördern. Dabei sind die politischen Mitgestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene so groß wie sonst nirgendwo.
Den Gemeinden als ausführenden Organen wird das Recht garantiert, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“ (Art. 28 Abs. 2 GG). Das bedeutet, dass sie in der Regel freien Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung übertragener Selbstverwaltungsaufgaben haben und nicht an spezielle Vorgaben gebunden sind. Regelmässige Diskussionen zeigen, wie weit das reichen kann.
Die Kommune ist der Ort, wo Politik anfängt. Politikwissenschaftler
bezeichnen die Kommunalpolitik sogar als „Schule der Demokratie“. Hier können
die Bürgerinnen und Bürger Ihre Wünsche äußern, Erfahrungen teilen und
letztendlich mitbestimmen. Jede Entscheidung, die auf kommunaler Ebene
getroffen wird, hat Auswirkungen auf das alltägliche Leben, beeinflusst aber
auch die Landespolitik und zum Teil auch darüber hinaus. (Kommunal-)Politik geht
also jeden etwas an. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sich auch jeder
einzelne beteiligt.
Auf dieser Ebene des föderalen
Mehrebenensystems der Bundesrepublik haben die Gemeindemitglieder zahlreiche
Partizipationsmöglichkeiten, die sie kaum woanders haben und durch die sie auf
die Kommunalpolitik Einfluss nehmen können. Dazu gehören unter anderem die
Teilnahme an Einwohnerfragestunden, Initiativen, Bürgerbegehren und die
zahlreichen Mitbestimmungsmöglichkeiten zum Beispiel im Baurecht.
Die kommunale Selbstverwaltung ermöglicht eine
viel größere Nähe zu politischen Entscheidungen, als sie auf Bundes- oder
Landesebene möglich wäre, und klare Verantwortlichkeiten sorgen für mehr
Transparenz.
Für kommunalpolitisch Interessierte kann sich
ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde also durchaus lohnen. Unerlässlich
ist allerdings der Wille mitzugestalten. Wer Veränderung will, muss selbst
verändern!

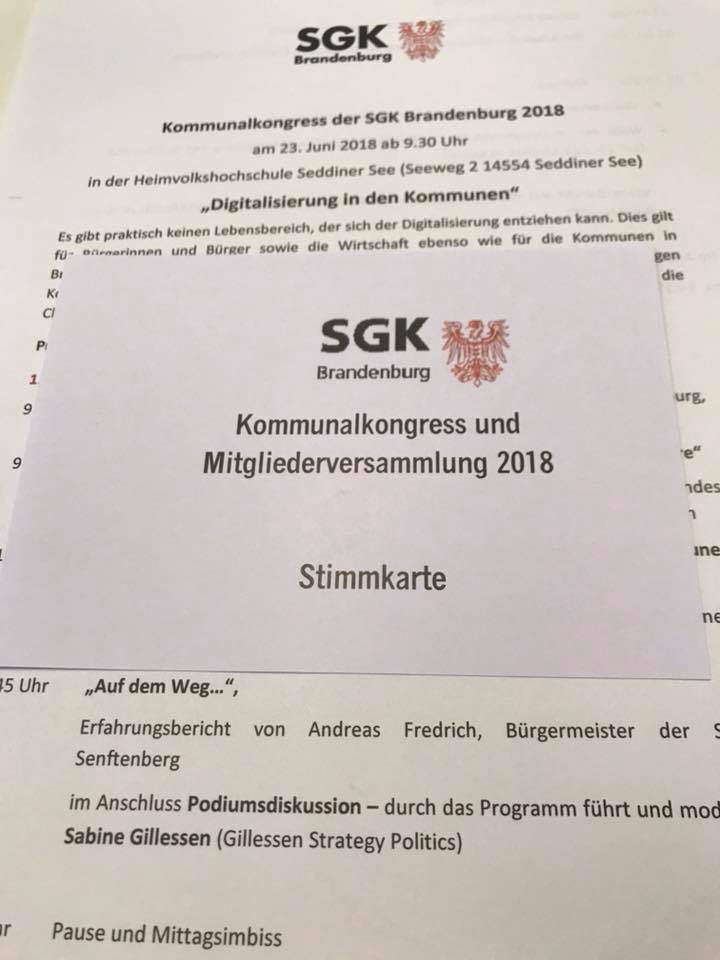
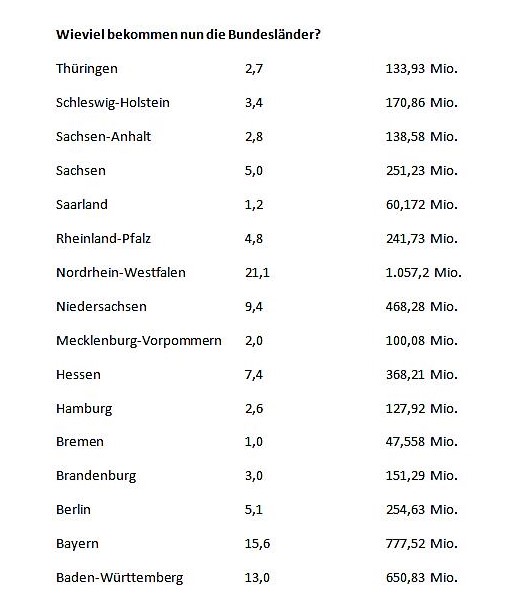

 Auf Einladung der Kommunalakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, unterstützt von der Bundes-SGK, fand vom 5. bis zum 8. Juli 2018 in Starachowice / Polen eine Fachkonferenz zu den aktuellen Herausforderungen der Kommunalpolitik in den Nachbarländern, Deutschland und Polen, statt. Daran nahmen Vertreterinnen und Vertretern des Netzwerks der progressiven Stadthalterinnen und Stadthalter, Abgeordnete und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus
Auf Einladung der Kommunalakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, unterstützt von der Bundes-SGK, fand vom 5. bis zum 8. Juli 2018 in Starachowice / Polen eine Fachkonferenz zu den aktuellen Herausforderungen der Kommunalpolitik in den Nachbarländern, Deutschland und Polen, statt. Daran nahmen Vertreterinnen und Vertretern des Netzwerks der progressiven Stadthalterinnen und Stadthalter, Abgeordnete und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus 




