DER VORSTAND DER SGK BRANDENBURG STELLT SICH VOR – Wiebke Papenbrock (MdB):
TESTTEST 123455
TESTTEST 123455
Videoaufnahme, Schnitt und Untertitel: Samuel Hildebrandt

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Rahmen und Grundlage der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit, wurde jüngst überarbeitet und ein Großteil der Bestimmungen ist zum 9. Juni 2024 bereits in Kraft getreten.
Obwohl die SGK Brandenburg dazu bereits einige Veranstaltungen abgehalten, die Neuerungen in Beiträgen unserer eigenen Zeitungen erläutert hat und die Folgen für die erste Sitzung der neu gewählten kommunalen Vertretungen in unseren Seminaren zu den konstituierenden Sitzungen (u. a. am kommenden Samstag, dem 22.6., siehe unter „Veranstaltungen“) eine Rolle spielen, ist kaum ein Gesetz wirklich selbsterklärend.
Um den Haupt- und Ehrenamtlerinnen in den Kommunen Sicherheit zu geben, hat das Ministerium des Innern und für Kommunales, deshalb ein Rundschreiben herausgegeben, in dem die Neuerungen erläutert und erklärt werden. Es lohnt sich ein Blick hineinzuwerfen!
Das Rundschreiben kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: Rundschreiben – bitte hier anklicken!



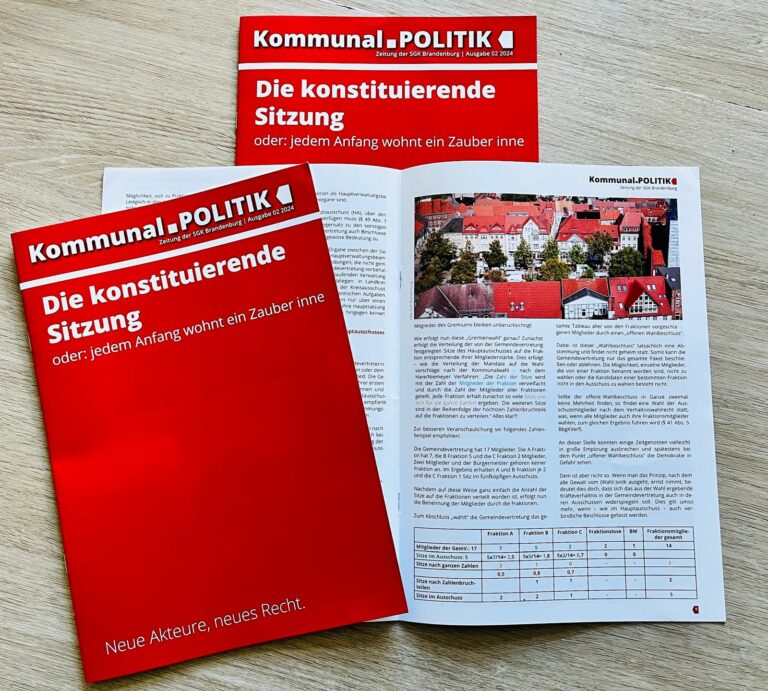

Lars Stepniak-Bockelmann, Projektverantwortlicher „Eberswalder Bürgerbudget“ und Vorsitzender der SPD Bernau
Diesen Slogan gab Frankfurt (Oder) unserem Bundesland im letzten Jahr. Denn Brandenburg ist bundesweit Spitzenreiter bei dieser besonderen Form der Bürgerbeteiligung. Über ein Drittel aller deutschen Bürgerhaushaltsverfahren haben ihr Zuhause in der Mark und fast jede zehnte Kommune hier nutzt dieses Beteiligungsinstrument.
Vor allem in den letzten zehn Jahren gab es eine rasante Entwicklung. Das lag vor allem am Eberswalder Bürgerbudget. Doch zunächst stellt sich die Frage „Was ist denn eigentlich ein Bürgerhaushalt?“.
Kurz gesagt: es ging immer um Beteiligung der Bürger*innen an den kommunalen Finanzen. Die Idee dazu schwappte vor 20 Jahren aus Brasilien (Porto Alegre), aber auch aus Neuseeland (Christchurch) nach Deutschland hinüber.
Im Land der Dichter(*innen) und Denker(*innen) wurde das Verfahren typisch „deutsch“ umgesetzt: sehr formell, stark reglementiert und natürlich nur beratend. Zudem gab es begleitend häufig noch dicke Broschüren mit Haushaltspositionen, Kennzahlen und Erläuterungen aus dem Zahlendschungel.
Der Gedanke, den Haushalt einer Stadt oder Gemeinde lesbarer zu gestalten, ist löblich. Doch er geht möglicherweise an den Interessen der Menschen etwas vorbei, auch wenn ich persönlich die Lektüre eines Haushaltsplans oder eines Jahresabschlusses spannend empfinde, so weiß ich immer, dass ich diesbezüglich sehr speziell bin. Dieses Gefühl hatte aber nicht jede Kämmerei zur damaligen Zeit.
Die Kommunen riefen dann zur Beteiligung auf und dem Ruf folgte größtenteils eine gewisse Gruppe von Menschen, die nicht selten männlich, älter, weiß und studiert waren sowie über ein gewisse Mobilität, zeitliche Flexibilität und rhetorische Fähigkeiten verfügte.
Es wurden Vorschläge eingereicht und die Verwaltungen schrieben seitenlange Begründungen. Dies wurde dann gebündelt der Kommunalpolitik zur Beschlussfassung vorgelegt. Der große Erfolg blieb aus und diese gesamte Herangehensweise ist sicherlich auch ein Grund, weshalb mehr gestorbene als aktive Bürgerhaushalte existieren.
Doch womöglich stimmt diese Aussage nicht mehr, denn die Bürgerhaushaltsfamilie hat in den letzten Jahren großen Zuwachs erfahren. Vor allem im Osten Deutschlands erfreuen sich Bürgerbudgets in kleinen und mittleren Kommunen großer Beliebtheit.
Vor zehn Jahren gab es in Brandenburg eine Handvoll Kommunen, die bereits Bürgerhaushalte durchführten – bspw. die Landeshauptstadt Potsdam, die Stadt Senftenberg in der Lausitz, aber auch die Barnimer Kreisstadt Eberswalde.
Seit 2008 wurden die Eberswalderinnen und Eberswalder an der Aufstellung des Haushaltsplanes beteiligt. Zugegebenermaßen war das alte Verfahren – ein konsultativer Bürgerhaushalt – nur bedingt von Erfolg gekrönt und konnte nicht wirklich zum Mitmachen animieren. Daher wurde 2012 nach einem neuen Verfahren Ausschau gehalten. Es sollte vor allem einfach, transparent und durchlässig sein. Zudem war es wichtig, dass die Resultate sichtbar sind und das Verfahren direktdemokratische Elemente trägt.
So entstand das Eberswalder Bürgerbudget. Man kann das ganze Jahr über Vorschläge einreichen und diese werden durch die Fachämter geprüft. Es gibt klare Kriterien, die in einer Satzung festgeschrieben wurden. So darf ein Vorschlag nicht mehr als 15.000€ kosten, durch die Stadt umsetzbar sein und keine Feier darstellen. Außerdem dürfen Begünstigte eine dreijährige Pause einlegen und keine Mittel aus dem Bürgerbudget erhalten, damit es nicht immer „dieselben Gewinner“ sind.
Die Abstimmung ist übrigens bindend. Das, was die Eberswalderinnen und Eberswalder am sog. „Tag der Entscheidung“ abstimmen, wird auch so umgesetzt. Nun könnte man meinen, dass vorher viele Vorschläge aussortiert werden – aber durchschnittlich sind 66% der Vorschläge gültig und gehen in die Abstimmung.
Übrigens ist die Abstimmung in Eberswalde sehr speziell: es wird vor Ort mit Stimmtalern abgestimmt. Hier hat ihre Stimme wirklich Gewicht: genauer gesagt 47,75 Gramm – so viel wiegen nämlich die 5 Stimmtaler, die jede*r Abstimmungsberechtigte erhält. Für jeden gültigen Vorschlag steht eine Vase bereit, die gefüllt werden möchte. Am Abend wird ausgezählt und das Ergebnis verkündet. Der Bürgermeister überreicht den Gewinner*innen dann die Danketaler, die bei den Projekten daran erinnern, dass die Eberswalderinnen und Eberswalder es ermöglicht haben.
Das erste Bürgerbudget fand 2012 in kleinerem Rahmen statt. Damals beteiligten sich 304 Eberswalderinnen und Eberswalder. Im zweiten Jahr gab es mit 1.011 eine lange Schlange, die über den Marktplatz entlang ging – um es zu verdeutlichen: da standen ziemlich viele Menschen an, um sich zu beteiligen. Es gab sogar einige Leute, die sich einfach anstellten, ohne zu wissen, was am Ende der Schlange auf sie wartet. Sie wurden dann quasi „zufällig“ und im Vorbeigehen beteiligt.
Wir mussten dann umziehen mit der Veranstaltung und haben sie zudem attraktiver gemacht. Zum Einen fand die Abstimmung nicht mehr unter der Woche an einem Abend statt, sondern nun an einem Samstag von 10 bis 18 Uhr und zum Anderen nehmen wir das Wort Beteiligungskultur sehr wörtlich und umrahmen die Abstimmungsveranstaltung mit Live-Musik, leckeren Speisen und Getränken sowie verschiedenen Mitmachangeboten.
9 Jahre. 9 Eberswalder Bürgerbudgets. 900.000€. 907 Vorschläge und 84 Gewinnerprojekte.
Zuletzt nahmen erneut über 2.500 Eberswalder*innen an der Abstimmung teil. Neu war die alternative Möglichkeit, online über das Eberswalder Bürgerbudget abzustimmen. Es sollte wie bei der Vor-Ort-Abstimmung einfach sein, die Stimmtaler auf die Vorschläge zu verteilen. Hierzu habe ich mal recherchiert und mit meinen privaten Daten an der Abstimmung eines anderen Bürgerbudgets teilgenommen. Dort musste ich Vorname, Nachname, E-Mail, Geburtsdatum, Straße, Stadt und Postleitzahl angeben, mir ein Passwort ausdenken, es wiederholen und die Bestätigungsmail anklicken. Dann war ich registriert und musste 1-2 Tage warten, dass meine Daten mit dem Melderegister abgeglichen wurden. Ich durfte natürlich nicht abstimmen, aber nach diesem Aufwand hatte ich auch keine wirkliche Lust mehr auf Beteiligung.
Hier in Brandenburgs Nordosten wollen wir es simpel gestalten. Es wurden der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum abgefragt. Um sicherzustellen, dass es wirklich die Person ist, wurden zur die letzten drei Zeichen der Personalausweisnummer abgefragt. In der gleichen Maske konnte man die Vorschläge für seine 5 Stimmtaler auswählen und direkt abstimmen. So wurden ca. 9.000 gültige Stimmtaler in die digitalen Vasen eingeworfen.
Es ist aber nicht selbstverständlich, dass eine Stadt solch ein Beteiligungsverfahren entwirft, umsetzt und es beständig weiterentwickelt. Dazu braucht es eine beteiligungsfreundliche Verwaltungsführung, eine Stadtpolitik, die sich als Mittlerin sieht und nicht zuletzt eine Einwohnerschaft, die diese Möglichkeiten nutzt. Kurzum: die Rathaustür sollte offen sein für gute Ideen.
Für Eberswalde hat es sich bisher ausgezahlt. Jedes Jahr aus Neue gibt es ein buntes Potpourri an Ideen. Sowohl der Verwaltung als auch der Politik steht es frei, weitere Vorschläge umzusetzen, die nicht durch das Bürgerbudget finanziert werden.
Positiv zu erwähnen ist auch, dass die Beteiligung am Bürgerbudget jung und weiblich ist. Seit Beginn der Datenerhebung haben immer mehr Frauen als Männer teilgenommen (auch überproportional der gesamten Stadtbevölkerung gegenüber). Vor allem bei Frauen zwischen 30 und 45 Jahren nehmen über 11% der Wahlberechtigten teil.
Eine weitere Überraschung liegt bei der Stimmgewalt der kleinen dörflichen Ortsteile. Viele Kommunen befürchten bei der Einführung, dass die bevölkerungsreiche Stadtmitte das Rennen macht. Es zeigt sich aber nicht nur bei uns, dass vor allem Projekte aus der Peripherie gewinnen. Dies liegt nicht zuletzt an der Gemeinschaft in den kleinen Ortsteilen – ein Zusammenhalt, der der Kernstadt möglicherweise nicht so geläufig ist.
Diese Erkenntnisse tragen wir sowohl beim Bundesnetzwerk „Bürgerhaushalt“ als auch beim Runden Tisch „Bürgerhaushalte in Brandenburg“ zusammen. Bisher gibt es alleine in Brandenburg mindestens 19 Töchterverfahren, also Bürgerhaushalte nach dem Eberswalder Modell mit entsprechenden Satzungen. Und gerade erreichte mich die Information, dass in der Uckermark weiterer Nachwuchs zu erwarten ist.
Ein Bürgerbudget hat nicht den Anspruch, eine Vision für die Entwicklung einer ganzen Stadt zu liefern. Hier geht es darum, sichtbare Ergebnisse zu liefern und Projekte umzusetzen. Die Einwohner*innen können selber entscheiden und im nächsten Jahr die Resultate sehen. Es schafft Vertrauen und aktiviert die Gesellschaft. Es wird übrigens je nach Kommune zwischen einem und acht Euro je Einwohner*in in das Bürgerbudget gesteckt.
Es gibt aber auch Verwaltungen, die behaupten, einen Bürgerhaushalt umzusetzen, weil sie ihren Haushaltsplan ins Internet hochladen. Man sieht: wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Die Zuversicht bleibt: keine Frühaufsteher wie Sachsen-Anhalt, keine Hochdeutschkenntnisse wie Baden-Württemberg, sondern „Brandenburg – Land des Bürgerbudgets“.
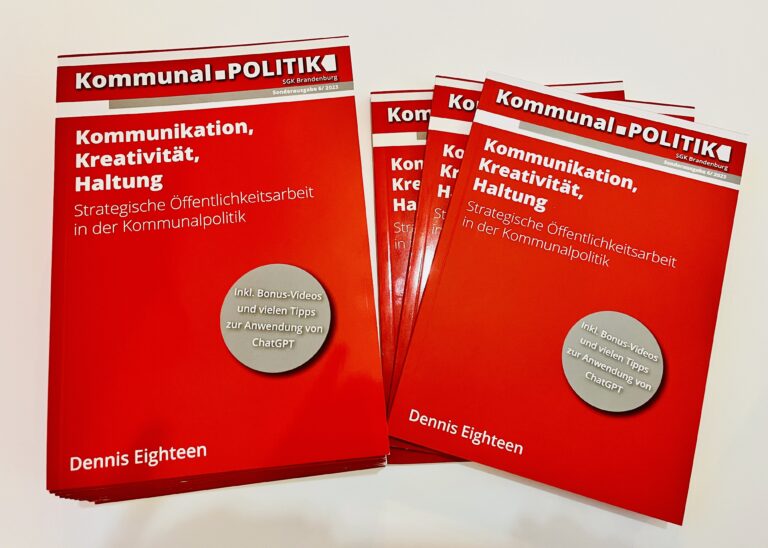
Wir freuen uns, dass die Sonderausgabe unserer Publikation, der Kommunal.POLITIK, die noch vor Weihnachten erschienen ist. Die Mitglieder der SGK Brandenburg haben sie bereits per Post erhalten.
Für all diejenigen, die zwar (kommunal)politisch aktiv oder interessiert sind, aber nicht bei uns Mitglied sind, haben wir eine begrenzte Anzahl vorgehalten. Damit so viele wie möglich davon profitieren können. Es enthält eine ganze Menge nützliche Information für die (kommunal)politische Arbeit, was man braucht oder wissen sollte, um sich der Öffentlichkeit mitzuteilen, aber auch um Informationen aufzunehmen.
Bei Interesse genügt eine E-Mail mit Namen und Adresse an: info@sgk-brandenburg.de.

von Birgit Morgenroth (mog)
Foto: Susanne Ruoff, o.T., 2010, Holz, Acrylfarbe, Ausstellung Galerie Ruhnke. Potsdam
Der Landtag hat im Sommer 2017 eine Ausstellungsvergütung für Künstlerinnen und Künstler in Einrichtungen der Landesverwaltung beschlossen. Nun liegt die Leitlinie des Kulturministeriums vor, die von allen Brandenburger Ministerien unterstützt wird. Künftig werden Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstler in den Räumen der Landesbehörden einheitlich honoriert. Das Honorar wird explizit als Anerkennung der künstlerischen Leistung gegeben und ist kein Produktionszuschuss. Gefördert werden vorrangig in Brandenburg lebende und/oder schaffende Künstler, die ein abgeschlossenes Kunststudium haben oder ihr künstlerisches Schaffen dokumentieren können.
Initiiert wurde der Antrag von Prof. Dr. Ulrike Liedtke, kulturpolitischer Sprecherin der SPD-Fraktion. Sie hat auf die prekäre Situation der meisten Brandenburger bildenden Künstler hingewiesen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen professioneller bildender Kunstschaffender, die allein vom Verkauf ihrer Kunst leben, beträgt 12.360 Euro. Schon aus diesem Grunde sei es wichtig, so Liedtke, dass alle Einrichtungen, die Ausstellungen präsentieren, dafür sensibilisiert werden, dass Künstlerinnen und Künstler für ihre Leistungen angemessen bezahlt werden. Es geht um die Wertschätzung von künstlerisch-kreativer Arbeit. Der Antrag knüpft an eine Initiative auf Bundesebene an, die auf eine Ausstellungsvergütung von bildenden Künstlerinnen drängt, da der Urheberrechtsschutz im Bereich der bildenden Kunst wenig bedeutend ist. Während in der Literatur oder in der Musik die massenhafte Produktion eines erfolgreichen Werkes die Gage für die Kulturschaffenden vervielfältigt, ist es in der bildenden Kunst das Gegenteil: Künstler verkaufen Originale, also Einzelstücke. Eine Ausstellung ist somit ein Blick auf einmalige Werke und sollte ähnlich wie das Anhören eines Liedes entsprechend honoriert werden. Wenn dies nicht durch einen Eintrittspreis möglich ist, wie in einem öffentlichen Gebäude oder einem Café, kann eine Ausstellungsvergütung diese finanzielle Honorierung übernehmen.
Die Kommunen und kreisfreien Städte können sich der Brandenburger Leitlinie anschließen und die Honorare dem Finanzvolumen ihrer Gemeinde oder Stadt anpassen. Jede Kommune verfügt über öffentliche Räume, die jetzt schon durch künstlerische Werke verschönert werden. Eine Ausstellung ist aber nicht nur zur Dekoration der Amtsräume da. Sie ist Ausdruck von Arbeit, regt manchmal zum Nachdenken an, manchmal hinterlässt sie Rätsel. Und es gibt Verfasserinnen und Verfasser, die von dieser Kunst ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Die Brandenburger Leitlinie sieht eine gestaffelte Vergütung vor, je nach Anzahl der Künstlerinnen und Künstler, die Ihre Werke präsentieren. Bei einer Einzelausstellung, die ein bis zwei Künstlerinnen und Künstler umfasst, werden 1000 Euro pro Teilnehmer bezahlt. Kleingruppen und Gruppenausstellungen erhalten 350 Euro bzw. 150 Euro als Honorar pro Kunstschaffenden.
Auf der Homepage des MWFK ist die Leitlinie zu finden http://www.mwfk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/851951