
Podiumsdiskussion – Das Ehrenamt mit Sicherheitsaufgaben im Wandel am 13. November in Rathenow
Bereits im Oktober des vergangenen Jahres konnten wir eine sehr erfolgreiche erste Veranstaltung zum Ehrenamt mit Sicherheitsaufgaben in Rathenow durchführen und möchten dies, wegen der Aktualität des Themas und des großen Interesses der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in diesem Jahr fortsetzen.
Vieles bewegt sich im Bereich des Ehrenamtes mit Sicherheitsaufgaben und vieles soll noch bewegt werden. So hat das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband sowie zahlreichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, im Rahmen von Regionalkonferenzen und Beratungsgesprächen ein Positionspapier erarbeitet. Die Landesregierung gestaltet derzeit entsprechende Rechtsgrundlagen. Gleichzeitig vergeht kaum ein Tag, an dem das Thema Ehrenamt sich nicht in den öffentlichen Medien findet.
Wir möchten die aktuelle Lage, aber auch bereits vorliegende Vorschläge, diskutieren und uns gemeinsam Gedanken darüber machen, welche Anreize geschaffen werden können um Behörden und Organisationen einsatzbereit zu halten und dieses Ehrenamt attraktiver zu gestalten.
Programm
Eröffnung und Begrüßung
durch Katja Poschmann, Mitglied der SGK Brandenburg
Gäste auf dem Podium:
Katrin Lange, Staatssekretärin im MIK Brandenburg
Werner-Siegwart Schippel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes e.V.
Daniel Weber, Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband Havelland e.V.
Marco Köhr, Leiter der Einsatzdienste ASB Ortsverband Nauen e.V.
Die Moderation wird von Felix Menzel übernommen, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land und aktiver Feuerwehrkamerad.
Alle Interessentinnen und Interessenten sind ganz herzlich eingeladen!
Weitere Informationen und Anmeldung: hier bitte klicken

„Vom Engagement zur Verantwortung“ Kommunalakademie 2018
Die Kommunalakademie der SGK Brandenburg richtet sich an Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie an Kommunalpolitik interessierte Bürgerinnen und Bürger jeder Generation. Relevante Themen und Fragen der kommunalen Selbstverwaltung, der Landkreise, Städte und Gemeinden werden grundlegend und vertiefend behandelt.
Die Kommunalakademie 2018 findet an vier Wochenenden im September, Oktober und Dezember statt:
am 28. und 29. September 2018 (1. Block) sowie
am 19. und 20. Oktober 2018 (2. Block)
jeweils ab 17 Uhr im Hotel und Gasthaus Zum Eichenkranz, Unter den Eichen 1, 14943 Kolzenburg
und
am 7. und am 8. Dezember 2018 (3. Block) sowie
am 14. und 15. Dezember 2018 (4. Block)
jeweils ab 17 Uhr in der Heimvolkshochschule am Seddiner See, Seeweg 2, 14554 Seddiner See
hier findet ihr das gesamte detaillierte Programm (bitte anklicken): Kommunalakademie 2018
Nahe beieinander – aktuelle Herausforderungen der Kommunalpolitik in Polen und Deutschland
 Auf Einladung der Kommunalakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, unterstützt von der Bundes-SGK, fand vom 5. bis zum 8. Juli 2018 in Starachowice / Polen eine Fachkonferenz zu den aktuellen Herausforderungen der Kommunalpolitik in den Nachbarländern, Deutschland und Polen, statt. Daran nahmen Vertreterinnen und Vertretern des Netzwerks der progressiven Stadthalterinnen und Stadthalter, Abgeordnete und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Ostrów Wielkopolski, Słupsk, Poznań, Dąbrowa Górnicza, Świdnica sowie Czersk, Sławków, Gorlic und Sejny teil, aber auch kommunale Vertreter aus Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und nicht zuletzt Brandenburg sowie Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Bundes-SGK teil.
Auf Einladung der Kommunalakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, unterstützt von der Bundes-SGK, fand vom 5. bis zum 8. Juli 2018 in Starachowice / Polen eine Fachkonferenz zu den aktuellen Herausforderungen der Kommunalpolitik in den Nachbarländern, Deutschland und Polen, statt. Daran nahmen Vertreterinnen und Vertretern des Netzwerks der progressiven Stadthalterinnen und Stadthalter, Abgeordnete und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Ostrów Wielkopolski, Słupsk, Poznań, Dąbrowa Górnicza, Świdnica sowie Czersk, Sławków, Gorlic und Sejny teil, aber auch kommunale Vertreter aus Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und nicht zuletzt Brandenburg sowie Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Bundes-SGK teil. 
Die Konferenz war in mehrere thematische Abschnitte gegliedert, dabei wurden nicht zuletzt best practice Beispiele zwischen den deutschen und den polnischen Kommunalpolitikern ausgetauscht. Dabei zeigte sich, dass die Probleme der Kommunen in den beiden Ländern manchmal nicht weit auseinander liegen, die Lösungen zum Teil jedoch schon. Insbesondere im Tagungsort spielte das Wort „Revitalisierung“ einzelner Ortsteile oder einer gesamten Stadt eine große Rolle, wie Marek Materek, der junge Stadtpräsident von Starachowice, und Aneta Nasternak, eindrucksvoll schilderten.
 Von deutscher Seite erläuterte Jürgen Kanehl, Vorstandsmitglied der Bundes-SGK, seine Erfahrungen in der Wohnraumpolitik, insbesondere unter dem Aspekt der Bezahlbarkeit und die Bürgermeisterin Nicole Sander aus Neunkirchen-Seelscheid in Nordrhein-Westfalen und Gerhard Lemm, Bürgermeister aus Radeberg in Sachsen , schilderten ihre Erfahrungen zur lokalen Demokratie.
Von deutscher Seite erläuterte Jürgen Kanehl, Vorstandsmitglied der Bundes-SGK, seine Erfahrungen in der Wohnraumpolitik, insbesondere unter dem Aspekt der Bezahlbarkeit und die Bürgermeisterin Nicole Sander aus Neunkirchen-Seelscheid in Nordrhein-Westfalen und Gerhard Lemm, Bürgermeister aus Radeberg in Sachsen , schilderten ihre Erfahrungen zur lokalen Demokratie.
Beate Klimek, Stadtpräsidentin aus Ostrów Wielkopolski konnte ebenfalls zu neuen Wohnprojekten in ihrem Wirkungsbereich berichten und Ewa Calus, stellvertretende Bürgermeisterin von Wadowice konnte, wie zuvor der brandenburgische Bürgermeister, Thomas Schmidt (Teltow), einen Input zur kommunalen Energie- und Klimapolitik geben. Im Mittelpunkt standen bei ihm kommunale Klimaschutzkonzepte, die Einbindung der Gemeindevertretung und auch Fragen um die so genanten Bürgersolaranlagen. Auf Nachfragen des Stadtpräsidentin des Tagungsortes kamen dann auch die energetische Verwertung von Abfall in Abgrenzung zur thermischen Beseitigung zur Sprache.


Zur Stärkung der Demokratie auf lokaler Ebene durch Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in das Regierungshandeln und Erhöhung der Transparenz sprach Robert Biedroń, Stadtpräsident von Słupsk, einer 92.000-Einwohner-Stadt zwischen Stettin und Danzig im Norden des Landes. Dabei ging er sowohl darauf ein, warum es für die Bürgerinnen und Bürger so wichtig ist, umfassend informiert zu sein, um sich selbst aktiv einbringen zu können, aber auch auf das, was er in seiner Stadt dafür tut. Dazu gehört unter anderem, dass seine Terminkalender vollumfänglich veröffentlicht ist, aber auch dass aktuelle Haushaltszahlen Schautafeln bereits am Eingang des Rathauses, in jeder Hinsicht sichtbar, gezeigt werden. 
Die Bürgermeisterin von Czersk, Jolanta Fierek, schilderte eindrücklich von der Unterstützung, die sie, nicht zuletzt von Starachowice, aber auch durch andere Amtskolleginnen und -kollegen nach dem Hurrikan im letzten Jahr erhalten hatte.
Durch die Veranstaltung führte kompetent Dariusz Szwed, Koordinator des Netzwerkes.
Im Herbst diesen Jahres finden in Polen Regionalwahlen statt.

Alle wollen fahren…aber wer bezahlt die Straße?
Der Artikel aus dem Brandenburg-Regionalteil der DEMO nun auch online auf den Seiten der DEMO:

Der Vorstand der SGK Brandenburg e. V. zur Fortentwicklung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes
Das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz soll fortentwickelt und noch in diesem Jahr überarbeitet werden. Seit dem 17. April liegt dem Landtag in Brandenburg unter der Drucksachennummer 6/315 nunmehr ein entsprechender Entwurf des „Siebenten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes“ als Unterrichtung vor.
Bereits in einer Stellungnahme des Ministerpräsidenten vom 15. November letzten Jahres, nach Absage der Verwaltungsreform, war deutlich geworden, dass eine Reform zum Jahr 2019 mit strukturellen Verbesserungen im Brandenburgischen FAG geplant wurde. Hinzu kommen entsprechende Äußerungen des Finanzministers, der darüber hinaus eine Erhöhung der so genannten Verbundquote ankündigte. Nur kurze Zeit später äußerte sich ebenfalls die Fraktion der SPD im Landtag Brandenburg und wies in einer Pressemitteilung nach einer Fraktionsklausur darauf hin, dass der Anteil der Kommunen an den Landeseinnahmen zu erhöhen sei, indem die Verbundquote in zwei Schritten von 20 auf dann mindestens 21,6 Prozent erhöht werden solle.
Zu den anstehenden Änderungen im FAG beriet sich dann im Februar und im März diesen Jahres unter anderem der FAG-Beirat auf der Grundlage eines Gutachtens des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln zum kommunalen Finanzausgleich in Brandenburg vom März 2018, das vom
Ministerium der Finanzen in Auftrag gegeben worden war. Die Gutachter prüften in diesem regelmäßig beauftragten Symmetriegutachten, ob die Finanzverteilung in den letzten Jahren zwischen dem Land und den Kommunen entsprechend der Aufgaben und Lasten „gerecht“ oder angemessen erfolgte.
Für die SGK Brandenburg hat die Überarbeitung des FAG schon deshalb eine große Bedeutung, weil es die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen zu einem erheblichen Maße bestimmt. Es zeichnet sich jedoch ab, dass statt struktureller Änderungen mit dem Gesetzentwurf lediglich Justierungen vorgenommen werden sollen.
So sehr die SGK Brandenburg eine Erhöhung der Verbundquote begrüßt, ist sie mit jeweils 0,8 Prozentpunkten für die Jahre 2019 und 2020 deutlich zu niedrig angesetzt. Dies widerspricht nicht zuletzt den Aussagen des Symmetriegutachtens. Diese umfassen unter anderem eine Erhöhung der Verbundquote um 2,22 bzw. 2,43 Prozentpunkte zugunsten der kommunalen Ebene gegenüber einem Umfang von gegenwärtig 20 Prozent (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Bbg-FAG), eine Beibehaltung der gegenwärtigen Bemessung der Teilschlüsselmasse, eine Beibehaltung der Hauptansatzstaffel in der gegenwärtig in § 9 BbgFAG geregelten Form sowie eine Fortschreibung und Erweiterung der investiven Schlüsselzuweisungen nach Auslaufen des Solidarpakts II ab dem Jahr 2020.
Den Ergebnissen zur Verbundquote lag unter anderem die Erkenntnis zugrunde, dass die Kommunen – so das Gutachten – in den Jahren 2012 bis 2016 eben nicht auskömmlich finanziert wurden und mithin nicht entsprechend ihrer Aufgabenbelastung an den überproportional gewachsenen Steuereinnahmen des Landes beteiligt wurden. Die Kommunen haben also vier Jahre lang weniger Zuweisungen erhalten, als ihnen eigentlich zustände. Das Ministerium der Finanzen ging jedoch bereits in seiner ersten Bewertung davon aus, dass die Verbundquote in zwei Schritten lediglich um jeweils 0,8 Prozentpunkte angehoben werden solle.
Zudem wies es darauf hin, dass die Untersetzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2019/2020 bereits avisiert sei und somit weder die Stufenregelung noch die Höhe abgeändert werden könnten. Zutreffend ist daran allenfalls, dass bislang die weit weniger und durchaus abänderbaren Eckwerte festleget wurden. Die Entscheidung über den Landeshaushalt liegt letztlich beim Parlament.
Die SGK Brandenburg kann dem nicht folgen und spricht sich für eine deutliche Erhöhung der Verbundquote nach den Vorgaben des Gutachtens aus, nicht zuletzt weil die bisherigen Vorschläge aus Regierung und Parlament deutlich unter dem liegen, was das vom Finanzministerium beauftragte Gutachten vorschlägt und weil auch die anhaltende Unterfinanzierung der Vergangenheit, mit entsprechenden Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft der Kommunen, nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Auch wenn die Zuwendungen an die Kommunen, so eine Pressemitteilung des Finanzministeriums vom 3. April 2018, sich derzeit auf einem „Rekordniveau“ befänden, ist dennoch im Blick zu behalten, dass dies nicht anhaltend der Fall sein wird, die Unterfinanzierung der Vergangenheit aber weiterhin auch in die Gegenwart und in die Zukunft wirken.
Die Erhöhung der Verbundquote ist kein Selbstzweck. Sie dient dazu eine kraftvolle kommunale Selbstverwaltung flächendeckend zu sichern. Dem aber werden die bisherigen Vorschläge nicht gerecht.
Zudem sollen, normiert in §5 des Entwurfes, durch eine Weiterentwicklung des Soziallastenausgleichs soziale Lasten stärker als bisher berücksichtigt und so ein besserer Ausgleich zwischen den Kommunen erzielt werden. Erreicht werden soll dies durch eine Vorwegentnahme aus der Verbundmasse in Höhe von 60 Millionen Euro. In der Höhe bewegt sich damit die Entnahme ohnehin im Maximalbereich dessen, was nach entsprechenden Gutachten vertretbar wäre, um den verfassungsrechtlichen unbedenklichen Anteil von Vorwegentnahmen aus der Finanzausgleichsmasse nicht zu überschreiten. Die SGK Brandenburg hat jedoch Zweifel an der in dem Entwurf dargelegten Verfassungsfestigkeit. Denn tatsächlich wird dabei davon ausgegangen, dass Steuereinnahmen sich verbessern, wenigstens aber gleich bleiben. Fallen diese jedoch, würden die Verbundmasse und die Finanzausgleichsmasse absinken, während der in der Summe festgelegte Beitrag für die Vorwegentnahme unverändert bliebe. Ob dies dann noch verfassungsrechtlich unbedenklich wäre, ist fraglich.
So sehr die SGK Brandenburg den Soziallastenausgleich grundsätzlich begrüßt, hält sie die Vorwegentnahme angesichts der Maximalhöhe und durch die Festlegung eines Festbetrages deshalb für bedenklich.
Hinzu kommt, dass nach Auslaufen des Solidarpaktes II im Jahr 2019 ab dem 2020 die gesetzliche Basis für die investiven Schlüsselzuweisungen fehlt. Aus ihnen wurden in etwa 25 Prozent der kommunalen Investitionen finanziert, die zukünftig wegfielen. Auf Anregung der kommunalen Seite wurde deshalb gutachterlich auch die Fortführung der investiven Schlüsselzuweisungen ab 2020 geprüft und in einer Größenordnung von ca. 100 Millionen Euro auch befürwortet. Dahingehend fehlt es jedoch an konkreten Umsetzungsvorschlägen.
Wünschenswert wäre eine Orientierung am Gesamtvolumen des kommunalen Investitionsprogrammes.Die SGK Brandenburg spricht sich sehr deutlich für eine Fortschreibung der investiven Schlüsselzuweisungen und eine Verstetigung aus, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass dies weder zu Lasten der Verbundmasse noch der Schlüsselzuweisungen gehen darf.
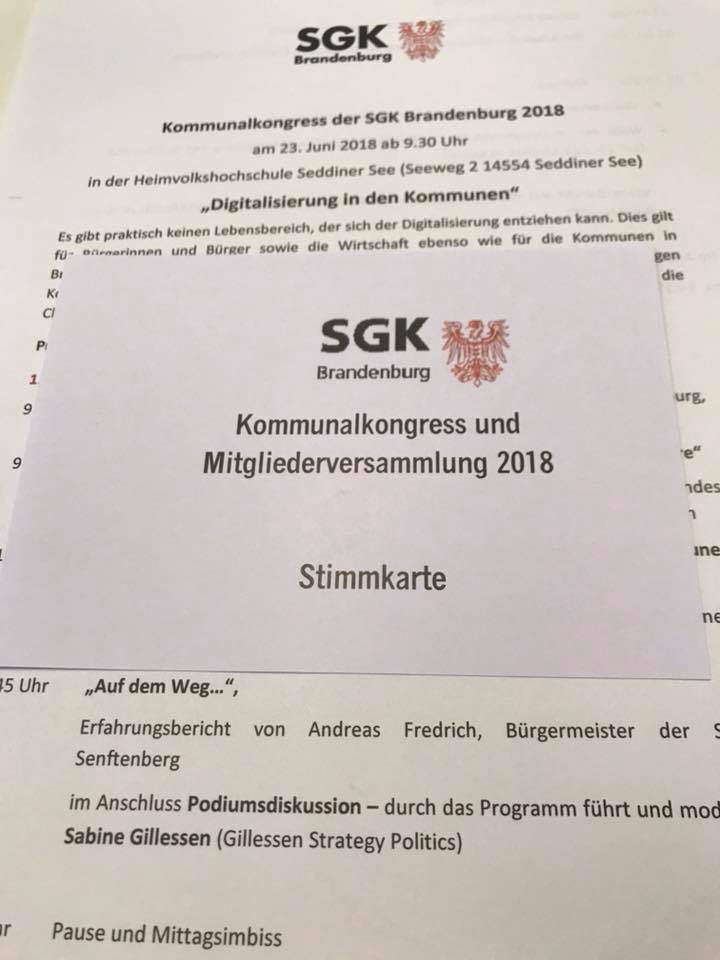
Einladung zum Kommunalkongress der SGK-Brandenburg am 23. Juni „Die Digitalisierung in den Kommunen“
Einladung zum
Kommunalkongress und zur Mitgliederversammlung der SGK Brandenburg 2018
am 23. Juni 2018 ab 9.30 Uhr
in der Heimvolkshochschule Seddiner See
„Digitalisierung in den Kommunen“
Programm
Erster Teil – Kongress
9.30 Uhr
Eröffnung durch den amtierenden Vorsitzenden der SGK Brandenburg,
Christian Großmann, Erster Beigeordneter der Stadt Ludwigsfelde
9.45 Uhr
„Die Digitalisierungsstrategie in Brandenburg – ein Prozess, viele Akteure“
Impulsreferat von Thomas Kralinski, Chef der Staatskanzlei und Beauftragter für Medien
10.15 Uhr
„Verwaltung.Einfach.Online – Digitale Verwaltung mit den Kommunen gestalten“
Impulsreferat von Katrin Lange, Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Kommunales
10.45 Uhr
„Auf dem Weg…“
Erfahrungsbericht von Andreas Fredrich, Bürgermeister der Stadt Senftenberg
im Anschluss Podiumsdiskussion – moderiert von Sabine Gillessen (Gillessen Strategy Politics)
12.00 Uhr
Pause und Mittagsimbiss
Zweiter Teil – Mitgliederversammlung
12.45 Uhr
Ehrung langjähriger Mitglieder der SGK Brandenburg
13.00 Uhr
Die Arbeit der SGK Brandenburg im Jahr 2018 – Herausforderungen und Chancen, vorgestellt von Christian Großmann
13.15 Uhr
Wahlen (Wahl eines Landesvorsitzenden /einer Landesvorsitzenden und der Delegierten
zu der Bundesdelegiertenversammlung der Bundes-SGK am 23./24.11.2018 in Kassel)
sowie Bericht aus der Bundespolitik von Manfred Sternberg (Geschäftsführer Bundes-SGK)
ca. 14.15 Uhr
Ende der Veranstaltung
Anmeldungen sind hier möglich: Kommunalkongress

Land: Leitlinie für Künstlerhonorare bei Ausstellungen – eine Idee auch für Kommunen?
von Birgit Morgenroth (mog)
Foto: Susanne Ruoff, o.T., 2010, Holz, Acrylfarbe, Ausstellung Galerie Ruhnke. Potsdam
Der Landtag hat im Sommer 2017 eine Ausstellungsvergütung für Künstlerinnen und Künstler in Einrichtungen der Landesverwaltung beschlossen. Nun liegt die Leitlinie des Kulturministeriums vor, die von allen Brandenburger Ministerien unterstützt wird. Künftig werden Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstler in den Räumen der Landesbehörden einheitlich honoriert. Das Honorar wird explizit als Anerkennung der künstlerischen Leistung gegeben und ist kein Produktionszuschuss. Gefördert werden vorrangig in Brandenburg lebende und/oder schaffende Künstler, die ein abgeschlossenes Kunststudium haben oder ihr künstlerisches Schaffen dokumentieren können.
Initiiert wurde der Antrag von Prof. Dr. Ulrike Liedtke, kulturpolitischer Sprecherin der SPD-Fraktion. Sie hat auf die prekäre Situation der meisten Brandenburger bildenden Künstler hingewiesen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen professioneller bildender Kunstschaffender, die allein vom Verkauf ihrer Kunst leben, beträgt 12.360 Euro. Schon aus diesem Grunde sei es wichtig, so Liedtke, dass alle Einrichtungen, die Ausstellungen präsentieren, dafür sensibilisiert werden, dass Künstlerinnen und Künstler für ihre Leistungen angemessen bezahlt werden. Es geht um die Wertschätzung von künstlerisch-kreativer Arbeit. Der Antrag knüpft an eine Initiative auf Bundesebene an, die auf eine Ausstellungsvergütung von bildenden Künstlerinnen drängt, da der Urheberrechtsschutz im Bereich der bildenden Kunst wenig bedeutend ist. Während in der Literatur oder in der Musik die massenhafte Produktion eines erfolgreichen Werkes die Gage für die Kulturschaffenden vervielfältigt, ist es in der bildenden Kunst das Gegenteil: Künstler verkaufen Originale, also Einzelstücke. Eine Ausstellung ist somit ein Blick auf einmalige Werke und sollte ähnlich wie das Anhören eines Liedes entsprechend honoriert werden. Wenn dies nicht durch einen Eintrittspreis möglich ist, wie in einem öffentlichen Gebäude oder einem Café, kann eine Ausstellungsvergütung diese finanzielle Honorierung übernehmen.
Die Kommunen und kreisfreien Städte können sich der Brandenburger Leitlinie anschließen und die Honorare dem Finanzvolumen ihrer Gemeinde oder Stadt anpassen. Jede Kommune verfügt über öffentliche Räume, die jetzt schon durch künstlerische Werke verschönert werden. Eine Ausstellung ist aber nicht nur zur Dekoration der Amtsräume da. Sie ist Ausdruck von Arbeit, regt manchmal zum Nachdenken an, manchmal hinterlässt sie Rätsel. Und es gibt Verfasserinnen und Verfasser, die von dieser Kunst ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Die Brandenburger Leitlinie sieht eine gestaffelte Vergütung vor, je nach Anzahl der Künstlerinnen und Künstler, die Ihre Werke präsentieren. Bei einer Einzelausstellung, die ein bis zwei Künstlerinnen und Künstler umfasst, werden 1000 Euro pro Teilnehmer bezahlt. Kleingruppen und Gruppenausstellungen erhalten 350 Euro bzw. 150 Euro als Honorar pro Kunstschaffenden.
Auf der Homepage des MWFK ist die Leitlinie zu finden http://www.mwfk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/851951

Seminar „Kommunales Bauland richtig entwickeln“ – Bericht von Nico Ruhle (Vorsitzender der SPD-Stadtfraktion Neuruppin)
Beschleunigte Bebauungsplanverfahren nach § 13a BauGB, städtebauliche Verträge, Anpassungsklauseln bei Erbbauzinsen und das sog. „Einheimischen-Modell“- als dies sind Teilnehmerinnen und Teilnehmern des SGK-Seminars „Kommunales Bauland richtig entwickeln“ am 14.04.2018 in Neuruppin spätestens jetzt keine Fremdwörter mehr.
Die anwesenden Mitglieder der SPD-Stadtfraktion und die weiteren Interessierten konnten zunächst ihr Wissen um Grenzen und Möglichkeiten des Bauplanungsrechts erweitern. Die Referentin Katrin Pollow, Amtsleiterin Stadtplanung und Fachbereichleiterin Bauleitplanung der Stadt Falkensee, vermittelte anschaulich, welchen Zweck die einzelnen Bauleitplanungsschritte haben und an welchen Stellen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker Gestaltungsspielräume gegeben sind. So konnten etwa durch Abschluss von städtebaulichen Verträgen mit Investoren allein in Falkensee mehrere Grundschulen und Teile des Abwassernetzes saniert bzw. gebaut werden. Mit Hilfe von Gestaltungssatzungen sollten Kommunen zudem für ein stimmiges architektonisches Gesamtbild sorgen.
Der Geschäftsführer des Deutschen Erbbaurechtsverbandes e.V., Dr. Matthias Nagel, nutzte die Gelegenheit, um in seinem Vortrag die Vorteile von Erbbaurechten darzustellen. Dabei berichtete er, dass es einer Umfrage des Erbbaurechtsverbandes zufolge wieder zu einer stärkeren Nachfrage nach Erbbaurechten bundesweit gekommen ist. Insbesondere große Städte sollen angesichts der drastisch gestiegenen Grundstückspreise und dem Bestreben, sozial verträgliche Mieten vorhalten zu können, verstärkt von der Bestellung von Erbbaurechten Gebrauch machen. In der Diskussion wurde deutlich, dass es offensichtlich Berührungsängste mit Erbbaurechten gibt, da das Eigentum am Grundstück selbst ja nicht erworben wird. Gleichzeitig war festzustellen, dass vor allem eine daran interessierte Kommunalverwaltung für eine Verbreiterung der Akzeptanz dieses baulichen Gestaltungsmittels sorgen kann. Gegenüber einer Veräußerung von Grundstücken führt die Bestellung von Erbbaurechten nicht zu einer Verminderung des kommunalen Anlagevermögens. Zudem sind Einnahmen aus den Erbbaurechten (Erbbauzinsen) nicht bei der Berechnung der Kreisumlage heranzuziehen und bleiben damit vollständig bei der Kommune. Damit können sie dauerhaft eine sichere Einnahmeposition in kommunalen Haushalten bilden.
Schließlich konnte die Bürgermeisterin der Ofenstadt Velten, Ines Hübner über ihre Pläne für ein sogenanntes „Einheimischen-Modell“ bei der Vergabe von Grundstücken berichten. Nach diesem vor allem im süddeutschen Raum weit verbreiteten Modell ist es möglich, für bereits in der Kommune lebende Bürgerinnen und Bürger ein Vorteil im Bieterverfahren geschaffen werden kann. Dabei müssen in dem auch nach EuGH-Rechtsprechung zulässigen Modell bestimmte Bedingungen wie etwa die Dauer des bisherigen Lebens in der Kommune oder ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllt sein. In einer Bewertungsmatrix könnten so für besonders heimatverbundene und gesellschaftlich engagierte Bewohnerinnen und Bewohner die Chance auf den Erwerb eines Baugrundstücks erhöht werden. Die ehemalige Vorsitzende der SGK Brandenburg stellte dabei insbesondere auf junge Familien ab, denen es angesichts stetig steigender Immobilienpreise immer schwerer fallen würde, ein für sie erschwingliches Baugrundstück zu erwerben.

Neben den tollen Referenten, die stets auf alle Nachfragen eingegangen sind und ihr profundes Wissen gut vermitteln konnten, trug die gute Organisation durch die SGK Brandenburg und ihrer Geschäftsführerin Rachil Rowald sowie das Schüler-Café Tasca zu einem rundum gelungenen Seminartag bei. Nachahmung sehr zu empfehlen!
Autor: Nico Ruhle, Vorsitzender der SPD-Stadtfraktion Neuruppin

Bund: Reform der Grundsteuer – mit kurzer Frist und langem Übergang
Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften des Bewertungsgesetzes für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Die derzeit geltenden Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundstücken für die Grundsteuer seien seit dem 1.1.2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar und sollen deshalb bis spätestens 31.12.2019 durch eine Neuregelung ersetzt werden. Damit ist klar, dass die Bewertung dieser für die Kommunen wichtigen Steuer, auf der Grundlage der Einheitswerte keinen Bestand hat. Das war erwartbar, beruhen sie doch ein Werteverhältnissen von 1964 (West) und 1935 (Ost). Das jahrzehntelange Unterbleiben einer Wertanpassung an die Wertverhältnisse habe dabei zu einem weitgehenden Verlust eines einheitlichen, am gemeinen Wert ausgerichteten Bewertungsmaßstabs und zu zur Wertverzerrungen innerhalb des Bereichs bebauter und unbebauter Grundstücke geführt. Das Urteil ist hier zu finden: bitte anklicken
Dem Bundesgesetzgeber wurde von den Richtern zugleich auferlegt bis spätestens Ende 2019 eine Neuregelung zu treffen, wobei der Verwaltung weitere fünf Jahre für deren Umsetzung eingeräumt wurden.
Für die Zukunft hat das Gericht die Fortgeltung der beanstandeten Regelungen angeordnet:
- zum einen sollen die beanstandeten Regelungen bis zum Ergehen einer Neuregelung aber längstens bis zum 31.12.2019 anwendbar sein und
- die Anwendung der als unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG festgestellten Bestimmungen der Einheitsbewertung ist für weitere 5 Jahre nach Verkündung der Neuregelung, längstens aber bis 31.12.2024, zulässig
Diese ungewöhnliche Konstellation beruht nicht zuletzt auf der Bedeutung der Grundsteuer, aber auch darauf, dass knapp 35 Millionen Einheiten nunmehr zu bewerten sind.
Der Erhalt der Grundsteuer muss dabei an erster Stelle stellen, denn tatsächlich ist sie einer der wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden und deshalb unverzichtbar. So beträgt das bisherige Grundsteueraufkommen der Kommunen insgesamt fast 14 Mrd. Euro/Jahr. Die Zeit für eine politische Einigung zwischen den Koalitionspartnern und mit den Ländern ist jedoch knapp bemessen, insbesondere dann, wenn man sich noch an die Verhandlungen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer und erinnert. Erste Treffen mit den Finanzministerien der Länder und dem Bundesfinanzministerium fanden jedoch bereits statt. Würden die Fristen des Bundesverfassungsgerichts nicht eingehalten werden, könnte dies dazu führen, dass die Kommunen ab 2025 keine Grundsteuer mehr erheben können.
Geklärt werden muss die Frage, ob die Grundsteuer weiterhin in Abhängigkeit vom Wert des Grundvermögens bemessen werden soll. Bei der Auswahl des Steuergegenstands gestehen die Verfassungsrichter dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum zu und die Verwendung mehrerer Maßstäbe zur Steuerbemessung wird explizit als zulässig bezeichnet. Unangetastet sollte das Recht der Gemeinden bleiben , den Hebesatz für die Grundsteuer und damit die Steuerhöhe, festzulegen.
Im Vordergrund der Überlegungen steht, aus Sicht der SPD auf Bundesebene, unter anderem, dass Boden wie Gebäude dem jeweiligen Immobilieneigentümer wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vermitteln und die Höhe der Grundsteuer deshalb auch zukünftig nach dem Wert des Grundvermögens bestimmt werden soll. Gleichzeitig soll die absolute Belastung der Steuerpflichtigen überschaubar bleiben. Unternehmer sollen die (betriebliche) Grundsteuer als Betriebsausgabe/Werbungskosten steuerlich geltend machen und Vermieter, so die Bundes-SPD, als Betriebskosten auf die Mieter umlegen können. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Aufkommensneutralität, die aber nicht immer gleichzeitig auch Belastungsgleichheit bedeutet. Dies kann im Ergebnis auch dazu führen, dass es zu einer Umverteilung der Steuerlasten kommt.
Unabhängig davon wird deshalb auch zu diskutieren sein, wie sich eine Grundsteuerreform auf die Miete auswirkt und ob die Umlage der Grundsteuer auf die Mieten im Mietrecht anders geregelt werden muss. Wegen zu erwartender Belastungsverschiebungen stehen steuerliche Ent- und Belastungen bei den Bürgerinnen und Bürgern deshalb zur Diskussion.
